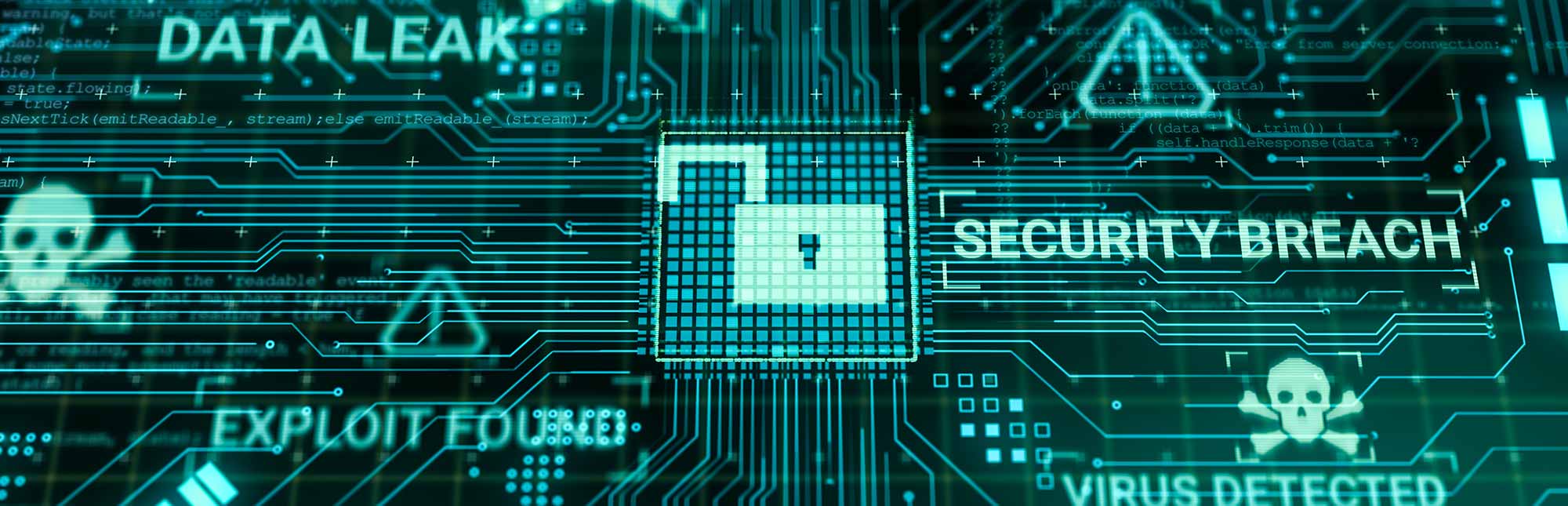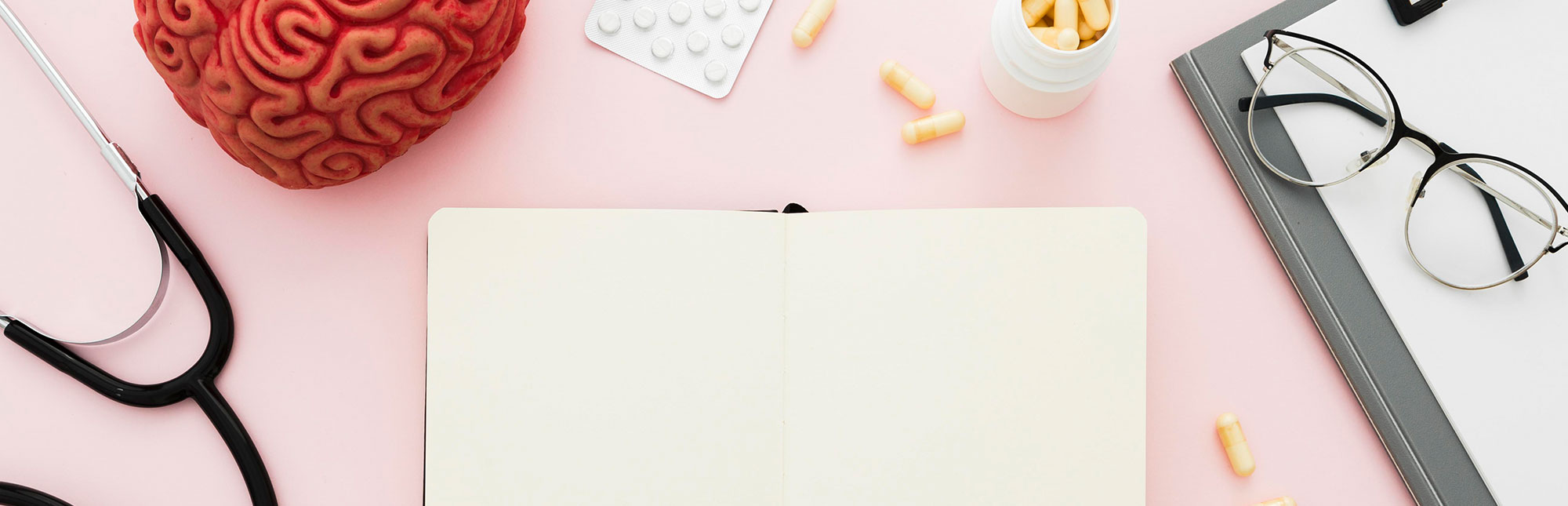Um möglichst viele potentielle Kunden zu bewerben, kaufen oder mieten Unternehmen bei Adresshändlern auf sie zugeschnittene Adressen. Unter dem Bundesdatenschutzgesetz a.F. war der Adresskauf unter dem sog. „Listenprivileg“ ausdrücklich geregelt und erlaubt. Die Datenschutz-Grundverordnung sieht das Listenprivileg nicht mehr vor. Der Beitrag behandelt die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Adresshandel unter der DSGVO noch zulässig ist.
“Die Nutzung gekaufter Adressen zum Zwecke postalischer Direktwerbung ist von der DSGVO gedeckt” – Eileen Binder
Anwendungsbereich DSGVO
Bestehen die Adressen lediglich aus Postanschriften von Unternehmen ohne konkreten Ansprechpartner, so fehlt es am Personenbezug und die Grundsätze der DSGVO können nicht herangezogen werden. Sobald ein Ansprechpartner im Unternehmen benannt ist, ist ein Personenbezug hergestellt und der Anwendungsbereich der DSGVO ist eröffnet. Dies gilt erst recht bei Verbraucher-Adressen.
Datenschutz vs. UWG
Ist der Anwendungsbereich der DSGVO eröffnet, ist die Datenverarbeitung nur zulässig, wenn eine Rechtsgrundlage diese erlaubt. Die DSGVO selbst bietet in Art. 6 einen abschließenden Katalog an möglichen Rechtsgrundlagen. Welche davon einschlägig ist, lässt sich oft anhand des Zwecks der Verarbeitung herausfinden. Unternehmen und Werbende, die Adressen aus einem Adresshandel kaufen, tun dies ausschließlich zu dem Zweck, Direktwerbung an die potentiellen Kunden zu versenden, in der Hoffnung den Absatz des eigenen Geschäfts zu fördern. Erwägungsgrund 47 der DSGVO schreibt im letzten Satz, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung als eine dem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden kann. Der Zweck ist also von der DSGVO anerkannt. Mit dem berechtigten Interesse wird daneben auch die einschlägige Rechtsgrundlage benannt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Nutzung der Adressen aus einem Handel ist damit jedoch noch nicht vollständig legitimiert. Ob die Verarbeitung tatsächlich erforderlich ist, um die berechtigten Interessen des werbenden Unternehmens zu wahren, ist im Rahmen einer Interessenabwägung zu prüfen. Erforderlich ist die Verarbeitung dann, wenn das Interesse am Adresshandel die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten des Werbeempfängers überwiegt. In die Abwägung sind regelmäßig Regelungen anderer einschlägiger Gesetze miteinzubeziehen. Allen voran steht das Gesetz zum unlauteren Wettbewerb (UWG). Nach § 7 Abs. 1 UWG ist Werbung per Telefonanruf oder E‑Mail eine unzumutbare Belästigung für den Werbeempfänger und grundsätzlich nicht erlaubt, es sei denn der Empfänger willigt in die Verarbeitung zu Werbezwecken ausdrücklich ein. Nicht erwähnt wird postalische Werbung. Sie gilt nach dem UWG als zumutbar und führt auch in der Interessenabwägung dazu, dass das berechtigte Interesse des Werbenden überwiegt. Die Nutzung gekaufter Adressen zum Zwecke postalischer Direktwerbung ist von der DSGVO gedeckt.
Weitere Voraussetzungen und Prozessmanagement
Einwilligung
Eine Einwilligung der Werbeempfänger in den Erhalt von Briefwerbung ist nach erfolgreicher Interessenabwägung nicht mehr notwendig. Etwas anderes gilt nur in den Fällen, in denen E‑Mail-Werbung versendet oder telefonische Werbung erbracht werden soll. Hier ist eine Prüfung im Einzelfall notwendig, da unter Umständen erneut § 7 UWG im Weg steht.
Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass der Werbende sich nicht darauf verlassen darf, dass die erworbenen Adressen aus einem legalen Adresshandel stammen. Der Werbende muss sich seinerseits, ggf. stichprobenartig, versichern, dass die Adressen des Händlers mit der Einwilligung der betroffenen Personen weitergegeben worden sind.
Art. 14 DSGVO
Der Werbende hat die Informationspflichten nach Art. 12 ff. DSGVO zu erfüllen. Da die Adressen im Falle des Adresshandels nicht direkt beim Werbeempfänger erhoben worden sind, sondern aus der Quelle eines Dritten stammen, sind die Voraussetzungen aus Art. 14 DSGVO zu beachten. Insbesondere muss über die Datenquelle, also den Adresshändler, und auch auch über das jederzeit zustehende Widerspruchsrecht gegen die Zusendung weiterer Werbung informiert werden. Hier sollte unbedingt angegeben werden, wie und wo der Widerspruch eingelegt werden kann.
Prozessmanagement
Im Rahmen des internen Prozessmanagements ist für den Adresshandel ein eigene Verarbeitung im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu erstellen. Über die technischen und organisatrischen Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die gekauften oder gemieteten Adressen ausschließlich durch die berechtigten Mitarbeiter zum vorgesehenen Zweck (Direktwerbung) verwendet und nach Zweckfortfall gelöscht werden. Eine Vermischung der Daten sollte zumindest solange unterbleiben, wie ein Werbeempfänger noch kein Kunde ist. Und schließlich sollten Prozesse für die Fälle des Betroffenenmanagements definiert sein, in denen der Werbeempfänger Widerspruch eingelegt hat oder seine Rechte auf Auskunft und / oder Löschung nach Art. 15, 17 DSGVO geltend macht.
Fazit
Die Nutzung von Adressen aus einem Adresshandel zum Zwecke der Direktwerbung ist grundsätzlich erlaubt. Regelmäßig werden dabei allerdings die Voraussetzungen nach dem UWG übersehen oder sogar nicht bekannt. Werden die erlangten Adressen für postalische Werbung genutzt, spricht nichts gegen die Verarbeitung. In diesen Fällen ist der Empfänger über sein jederzeitiges Widerspruchsrecht als auch die weiteren Voraussetzungen nach Art. 14 DSGVO zu informieren.
Artikel zum selben Thema:
Die NIS2-Richtlinie und deren Umsetzung: Neue Vorschriften zur Cybersicherheit für Unternehmen und Institutionen
Neuer Compliance-Hammer oder längst fällig? In Zeiten des digitalen Wandels rückt das Thema der Cybersicherheit, insbesondere für kritische Infrastrukturen, immer […]
DSA, DMA, AIA, NIS2 – Die Erweiterung des EU-Regelwerks für digitale Sachverhalte
Was sich anhört wie ein Satz aus einem beliebten deutschen Rap-Lied ist tatsächlich Teil der EU-Digitalisierungsstrategie für digitale Sachverhalte. […]
Das Verbandbuch und der Datenschutz
Die erforderliche Aufzeichnung geleisteter Erste-Hilfe-Maßnahmen in Unternehmen, Behörden, Kindertageseinrichtungen und in Schulen erfolgen in der Praxis meist in sogenannten […]