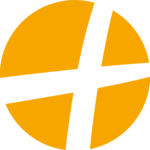Traueranzeigen enthalten oftmals die Bitte, auf Blumen- oder Kranzspenden zu verzichten und stattdessen einer sozialen Pflegeeinrichtung zu spenden. Gerade im Bereich der Hospiz- und Palliativarbeit sind solche Spendenaufrufe die Regel und entsprechen dem letzten Willen des Verstorbenen oder dem Wunsch der Hinterbliebenen. Welche Rolle der Datenschutz hierbei spielt, erläutern wir im folgenden Beitrag.
“Name und Spendensumme sind unstreitig personenbezogene Daten. Die Weitergabe dieser Daten stellt eine datenschutzrechtliche Verarbeitung dar und bedarf für deren Übermittlung an die Hinterbliebenen einer Rechtsgrundlage. In Frage kommen als Rechtsgrundlage eine vertragliche Beziehung, eine rechtliche Verpflichtung, ein berechtigtes Interesse der Angehörigen oder die Einwilligung des Spenders.” – Markus Spöhr
Seien es die Caritas, die Diakonie oder sonstige gemeinnützige Organisationen und Vereine. Sie alle kennen die Situation, dass sich nach einem erfolgreichen Spendenaufruf im Rahmen einer Traueranzeige, die Hinterbliebenen in Form eines persönlichen Anschreibens bei den Spendern bedanken möchten. Gerade bei hohen Geldsummen erscheint das häufig auch nachvollziehbar. Die Hinterbliebenen benötigen hierfür jedoch die Namen der Spender. Diese können Sie nur bekommen, indem Sie sich an die soziale Einrichtung wenden, da die Namen dort aus den Überweisungen ersichtlich sind. Doch wie sieht die datenschutzrechtliche Einordung aus und darf die Liste mit den Spenderdaten überhaupt übermittelt werden?
Vor Einführung der DSGVO wurden die Spenderlisten vielfach herausgegeben, häufig ohne dass sich die Einrichtungen Gedanken machten, ob die Herausgabe überhaupt rechtens ist. Doch spätestens mit der Einführung der DSGVO hat sich diese Praxis — nicht zuletzt mit Blick auf drohende Geldbußen — geändert.
Name und Spendensumme sind unstreitig personenbezogene Daten. Die Weitergabe dieser Daten stellt eine datenschutzrechtliche Verarbeitung dar und bedarf für deren Übermittlung an die Hinterbliebenen einer Rechtsgrundlage. In Frage kommen als Rechtsgrundlage eine vertragliche Beziehung, eine rechtliche Verpflichtung, ein berechtigtes Interesse der Angehörigen oder die Einwilligung des Spenders.
Kein Vertrag und keine rechtliche Verpflichtung
Da zwischen den Spendern und den Angehörigen keine vertragliche Beziehung besteht, scheidet Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSVO als Ermächtigungsgrundlage für die Weitergabe der Spenderdaten aus. Eine zivilrechtliche Vertragsbeziehung besteht allenfalls zwischen Spender und Empfänger der Spende.
Auch besteht keine rechtliche Verpflichtung, die die Herausgabe der Spendernamen rechtfertigen könnte. Sofern ein Spender seine Kontaktdaten angibt, erfolgt dies regelmäßig zum Zwecke der Ausstellung einer Spendenbescheinigung . Hieraus kann aber nicht gefolgert werden, dass der Spender die Daten zum Zwecke der Weitergabe für eine Danksagung übermittelte.
Berechtigtes Interesse
Auch die Weitergabe der Spenderdaten aufgrund Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO wird schwer konstruierbar sein. Zwar haben die Hinterbliebenen den Wunsch sich bei den Spendern zu bedanken, jedoch ist das Interesse der Angehörigen mit den Interessen der Spender abzuwägen. Pauschal von einem überwiegenden Interesse der Angehörigen auszugehen, wäre falsch und würde zum Beispiel nicht berücksichtigen, dass manche Spender ungenannt bleiben wollen und nicht damit rechnen mussten, dass Ihre Daten weitergegeben werden.
Einwilligung
Letztlich bleibt noch Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSVO, die Einwilligung als Ermächtigungsgrundlage übrig. Eine Einwilligung hat informiert zu erfolgen, d.h. der Einwilligende muss zum Zeitpunkt der Einwilligung wissen, welche Konsequenzen seine Einwilligung hat. Die Einwilligung der Spender als Rechtsgrundlage wird daher in der Praxis wohl regelmäßig scheitern. In der Regel findet der Spendenaufruf über eine Traueranzeige in einer oder mehreren regionalen Tageszeitungen statt. Ein Einwilligungstext mit allen erforderlichen Informationen am Ende einer Traueranzeige wäre wohl sehr befremdlich und würde den Rahmen sprengen. Darüber hinaus muss die Einwilligung grundsätzlich aktiv und in dokumentierter Weise erfolgen, was vorliegend kaum möglich erscheint.
Was nun?
Die strenge Anwendung der Datenschutzgrundverordnung kommt zu dem Ergebnis, dass die Spenderdaten nicht an die Angehörigen weitergegeben werden dürfen. Nach Ansicht der herrschenden Meinung haben die Angehörigen folglich keinen Anspruch auf die Herausgabe der Spendernamen.
Auch die Lösungsvorschläge (vgl. Nr. 3.5.4 des 3. Jahresbericht) der Diözesandatenschutzbeauftragten für die Erzdiözesen Köln und Paderborn sowie die Diözesen Aachen, Essen und Münster und Verbandsdatenschutzbeauftragten des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD) scheinen kaum zufriedenstellend.
Unproblematisch könne nach einer gewissen Zeit zumindest die gespendete Gesamtsumme mitgeteilt werden. Diese Information können die Hinterbliebenen dann in einer allgemein formulierten Danksagung zum Beispiel in einer weiteren Anzeigenschaltung verwenden.
Sofern die Angehörigen auf die Kenntnis der einzelnen Spender und der Beträge bestehen, bleibt ihnen nur übrig, dass Sie die Spenden selbst einsammeln und die gespendete Summe im Anschluss an die Einrichtung weiterleiten. So sind sie selbst Verantwortliche im Sinne der DSGVO und die Spenderdaten werden direkt bei Ihnen erhoben. Diese datenschutzrechtliche Lösung vernachlässigt aber die Möglichkeit der Ausstellung einer Spendenbescheinigung seitens der Angehörigen, was insbesondere gerade bei höheren Spenden oftmals eine Rolle spielt und möglicherweise zur Folge hätte, dass Spenden teilweise ausbleiben oder geringer ausfallen als ursprünglich gewollt. Ebenfalls bei dieser Lösung unberücksichtigt bleibt der Fall, dass sich die von der Spende berücksichtigte Einrichtung bei den Spendern bedanken möchte und hierfür ebenfalls gerne die Spenderdaten hätten. Das Problem würde also nur verlagert.
Datenschützer müssen sich im vorliegenden Falle eingestehen, dass eine strikte Anwendung der DSGVO keiner der Parteien wirklich weiter hilft. Ganz im Gegenteil, sie schafft Unzufriedenheit. Die Erfahrung in der Praxis zeigt, dass die Hinterbliebenen, nachdem Ihnen die Herausgabe der Spenderliste versagt wurde, aus Trotz oder Frustration möglicherweise zukünftig nicht mehr zu einer Spende aufrufen werden. Leidtragende sind die sozialen Einrichtungen und deren wichtige Arbeit, die teilweise auf die Spenden angewiesen sind.
Wir empfehlen deshalb: Schaffen Sie Transparenz. Sollten Sie eine soziale Einrichtung sein und es steht ein weiterer Spendenaufruf durch die Hinterbliebenen an, informieren Sie diese über die rechtlichen Gegebenheiten. So kann zumindest verhindert werden, dass Hinterbliebene sich im Nachgang über die Versagung der Herausgabe ärgern.
Artikel zum selben Thema:
Einwilligung – Drahtseilakt zwischen rechtlicher Ausgestaltung und praktischer Handhabung
Es begegnet uns nahezu alltäglich – das Erfordernis der Einwilligung. Im beruflichen wie auch im privaten Kontext. In der datenschutzrechtlichen […]
Interne Mitteilungen über Beschäftigte
Manche Dinge sind so trivial, man macht sie einfach. Aus Nettigkeit, aus Rücksicht, aus Freude, weil man eben muss […]
EU-US Data Privacy Framework – was lange währt wird endlich gut?
Am 10.07.2023 verabschiedete die EU-Kommission den neuen Angemessenheitsbeschluss für die USA – das Transatlantic Data Privacy Framework, kurz TADPF. […]